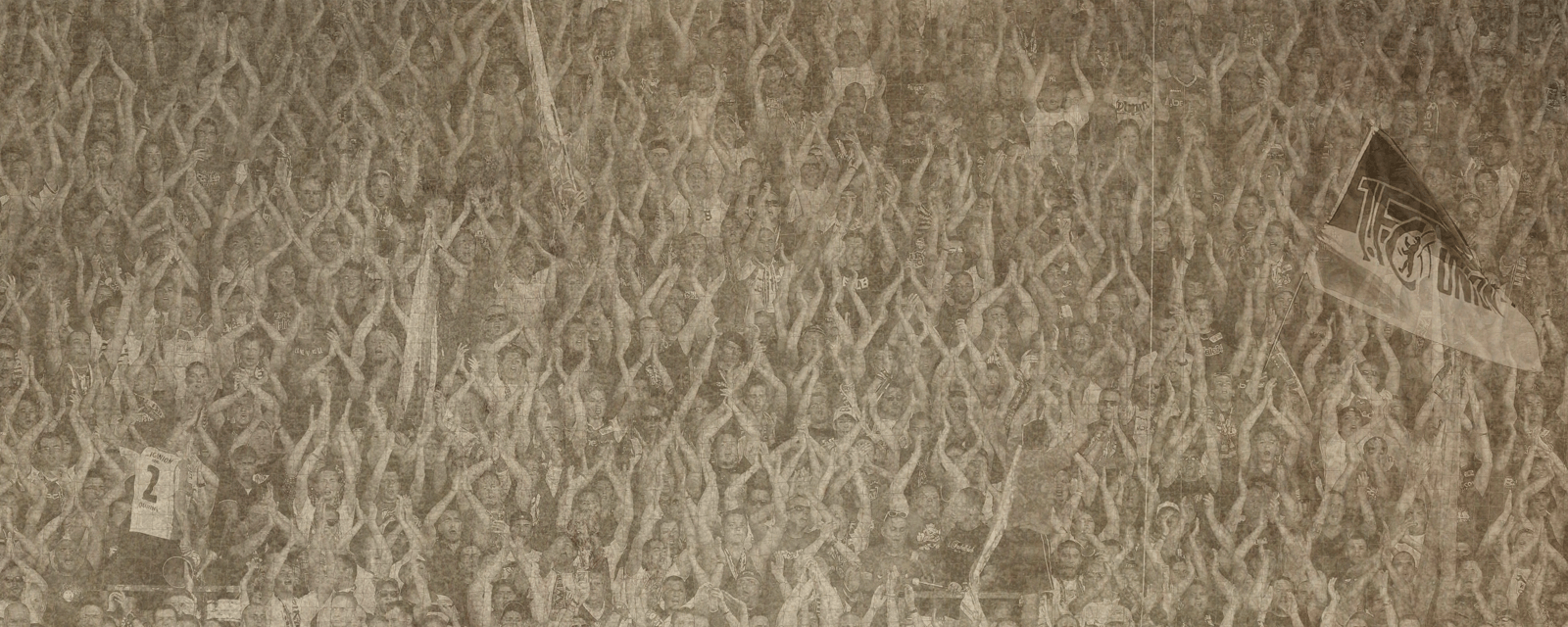Richterliche Informationspflichten nach einem „Deal“
Liebe Unioner,
ich hoffe, Ihr seid trotz der ganzen widrigen und auch besorgniserregenden Umstände gut in das neue Jahr gekommen. Hoffen wir, dass es ein Jahr wird, das uns möglichst schnell wieder zurück zu normalen Lebensverhältnissen führt und wünschen wir allen, die im Augenblick aufgrund der Pandemie um Ihre Gesundheit bangen müssen, baldige Genesung.
Zu Beginn des neuen Jahres mal wieder eine Information zum Strafverfahrensrecht.
Im allgemeinen Sprachgebrauch ist oft von einem sogenannten strafgerichtlichen „Deal“ die Rede. Was steckt eigentlich dahinter? Um es gleich voranzustellen, ein solcher „Deal“ soll auf gar keinen Fall in die Nähe irgendeiner Klüngelei zwischen den Verfahrensbeteiligten gerückt werden, sondern vielmehr ist es ein Versuch, in einem laufenden Verfahren eine vernünftige Lösung für den Angeklagten zu finden.
An solche Verfahrensabsprachen sind hohe Anforderungen gerichtet. Regelmäßig werden Verfahrensabsprachen nach einer Unterbrechung der Hauptverhandlung zwischen dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung geführt. Während dieser Gespräche wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen.
Was aber häufig unterbleibt und was dieses Gespräch auch darum oft etwas intransparent erscheinen lässt, ist die Anforderung an solche Verfahrensabsprachen, dass nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Fortsetzung der Hauptverhandlung, die Öffentlichkeit über den wesentlichen Inhalt der getätigten Absprache zu informieren ist. Die Missachtung dieser Vorschrift ist immer wieder Grund für daraufhin eingelegte Revisionen und führt letztlich auch zu Entscheidungen des Bundesgerichtshofes, dass Urteile nach Verfahrensabsprachen wieder aufgehoben werden, weil die gesetzlichen Vorgaben der Informationspflicht gegenüber der Öffentlichkeit nicht eingehalten wurden.
Es besteht hierzu in der Strafprozessordnung unter dem §§ 243 Abs. 4 eine Regelung, in der zum Ausdruck kommt, dass das Gericht, wie oben ausgeführt, umfangreich zum Inhalt der Gespräche, auch zu wesentlichen Argumenten der Verfahrensbeteiligten, informieren muss. Insbesondere soll dabei die Öffentlichkeit auch darüber informiert werden, wer eine mögliche Verständigung überhaupt angeregt hat, also die Klärung der Frage, ob die Initiative vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft oder von der Verteidigung ausging und es ist auch darüber zu informieren, welche Standpunkte die anderen Verfahrensbeteiligten zu einzelnen Vorschlägen eingenommen haben.
Dies ist unumgänglich und an sich auch logisch, weil sich aufgrund des Wissens über den konkreten Inhalt dieser Gespräche das weitere prozessuale Verhalten des Angeklagten richten wird. Im Einzelnen ist ja häufig Folge solcher Verständigungen, dass der Angeklagte bei Inaussichtstellung einer Strafe in einer bestimmten Höhe ein Geständnis abgibt oder aber z.B. auch Teile der ihm vorgeworfenen Taten zugesteht. Wenn der Angeklagte nun die Verfahrensabsprachen nicht kannte, konnte er sich auch nicht ordnungsgemäß verteidigen und kann gegen ein daraufhin ergangenes Urteil Berufung einlegen, was bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Informationspflichten über die Absprachen regelmäßig wieder aufgehoben werden dürfte.
Es bleibt festzustellen, dass eine solche Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten an sich eine sehr sinnvolle Sache ist, aber leider, insbesondere in der ersten Instanz vor den Amtsgerichten, die Umsetzung dieser Regelung, was die Dokumentation und Transparenz von solchen Absprachen angeht, häufig nicht eingehalten wird.
Eisern Union